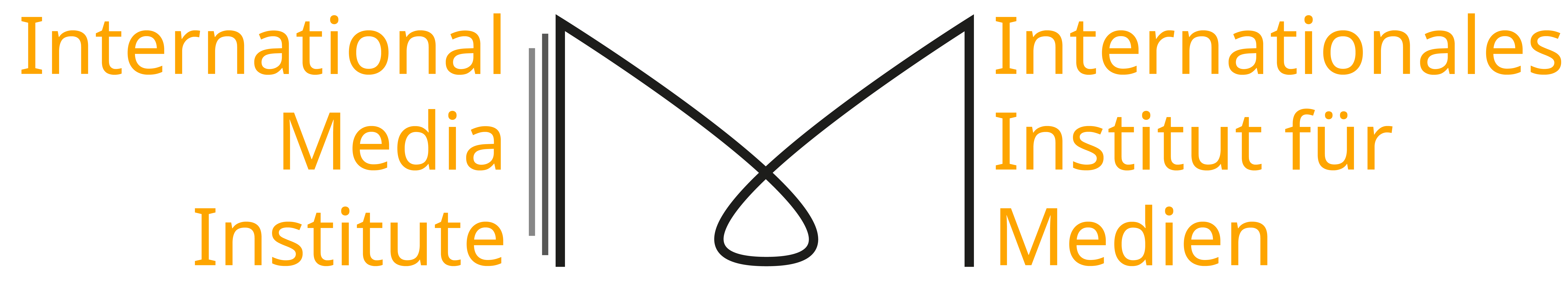Der Staatsvertrag und sein langer Weg durchs Parlament
Wien, 14. Mai 2025 – Der Moment, als Leopold Figl am 15. Mai 1955 für Österreich den Staatsvertrag unterzeichnete, ging in die Geschichte ein. “Österreich ist frei”, sagte der damalige Außenminister unmittelbar danach und präsentierte das Dokument vom Balkon aus den tausenden Menschen vor dem Schloss Belvedere. In Kraft getreten war der Vertrag, der Österreich zu einem unabhängigen Staat machen sollte, an diesem Tag aber noch nicht. Die vier Besatzungsmächte und auch das österreichische Parlament mussten ihn erst ratifizieren.
Vonseiten Österreichs gab der Nationalrat am 7. Juni und der Bundesrat am 8. Juni 1955 grünes Licht für den Staatsvertrag. Nachdem auch die Sowjetunion, die USA, Großbritannien und Frankreich ihre Zustimmung erteilten, konnte der Vertrag am 27. Juli 1955 in Kraft treten. Damit endete eine lange Reise des Dokuments. Das österreichische Parlament hatte sich fast neun Jahre lang und über drei Gesetzgebungsperioden hinweg mit der Freiheit und Unabhängigkeit Österreichs befasst. Begonnen hat alles mit einer geheimen Sitzung des Nationalrats.
Oktober 1946: Geheime Nationalratssitzung
Es ist der Nachmittag des 29. Oktobers 1946. Der Nationalrat tagt bereits seit Vormittag, auf dem Programm steht der Budgetentwurf für 1947, außerdem ein Suchtgiftgesetz und eine Einkommensteuernovelle. Um 15.35 Uhr verkündet Dritter Nationalratspräsident Alfons Gorbach (ÖVP), dass ein Bericht der Bundesregierung in geheimer Sitzung behandelt werden soll. “Ich ersuche daher die Herren Ordner des Hauses, mit Unterstützung der Beamten und Angestellten des Hauses die Räumung der Galerie vorzunehmen”, ordnet Gorbach an. Um 15.45 Uhr beginnt die geheime Sitzung des Nationalrats. Es sprechen Bundeskanzler Leopold Figl (ÖVP) und weitere Minister, ehe die Sitzung um 17.45 Uhr unterbrochen und am nächsten Tag um 14.05 Uhr fortgesetzt wird. Nach weiteren Wortmeldungen aus der Regierung bringen die Abgeordneten Julius Raab (ÖVP), Erwin Scharf (SPÖ) und Ernst Fischer (KPÖ) einen Resolutionsantrag ein.
“Der Nationalrat erwartet von der Regierung eine außenpolitische Orientierung, die durch gleicherweise freundliche Beziehungen mit allen Alliierten uns der vollen Souveränität näherbringt”, heißt es darin. Die Regierung solle sich um die “Herstellung der Freiheit und Unabhängigkeit Österreichs im Sinne der Moskauer Deklaration sowie die Sicherung der Einheit unseres Landes” bemühen. In der Moskauer Deklaration erklärten Großbritannien, die USA und die Sowjetunion 1943, Österreich von deutscher Herrschaft befreien und als unabhängiges Land wiederherstellen zu wollen. Die Abgeordneten sprechen sich für eine Beendigung der militärischen Besetzung, den Schutz der Demokratie und die Aufnahme in die UNO aus. Insgesamt elf Ziele gibt der Nationalrat der Regierung mit dieser Resolution vor, die schließlich einstimmig angenommen wird. Es handelt sich um die erste Entschließung des Parlaments für ein freies Österreich. Die parlamentarische Reise des späteren Staatsvertrags beginnt.
Am 30. Oktober um 17.15 Uhr ist die geheime Sitzung zu Ende. Von der Sitzung, den Rednern und der Resolution wissen wir heute, weil sie auf zwei Seiten des Stenographischen Protokolls festgehalten sind. Das hat der Nationalrat damals gemäß Geschäftsordnung beschlossen. Auch heute ist eine solche Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit übrigens laut Geschäftsordnung (§ 47 Abs. 2) bzw. Bundes-Verfassungsgesetz (Artikel 32) noch möglich. Es gab aber nach dem 30. Oktober 1946 keinen weiteren Fall.
1947: Hoffnungen werden erstmals enttäuscht
Nicht lange nach der Nationalratssitzung passiert im Dezember 1946 ein wichtiger nächster Schritt auf dem Weg zum Staatsvertrag. Beim Außenministerrat der Alliierten in New York werden Sonderbeauftragte, sogenannte Deputies, bestellt, die einen Vertrag mit Österreich vorbereiten sollen. Am 14. Jänner 1947 treten sie in London zu Beratungen zusammen. Einen Tag später, am 15. Jänner, berichtet Bundeskanzler Figl dem Nationalrat von dieser Konferenz. Er spricht von einem “besonders bedeutungsvollen Tag”, ehe er die aus österreichischer Sicht maßgebenden Fragen im Zusammenhang mit einem Staatsvertrag darlegt. 16 Punkte sind es insgesamt, neben der Wiederherstellung der Unabhängigkeit in den Grenzen des Jahres 1937, dem Ende der Besetzung und der demokratischen Verfassung geht es auch um die Beziehungen zu Deutschland und wirtschaftliche Fragen. “Möge das Jahr 1947, das so verheißungsvoll beginnt, uns wirklich die Erfüllung bringen”, schließt Figl. Danach ist im Protokoll “lebhafter, langanhaltender Beifall und Händeklatschen” dokumentiert.
In seiner Rede im Jänner hatte Figl sich optimistisch gezeigt, dass die endgültige Fassung des Staatsvertrags auf der Außenministerkonferenz in Moskau im März 1947 entschieden wird. Doch es kommt anders. In Moskau kommt es zu keiner Einigung, Gebietsforderungen von Seiten Jugoslawiens an Österreich und die Aufteilung von “deutschem Eigentum” machen Probleme bei den Verhandlungen. Am 7. Mai tritt Bundeskanzler Figl vor den Nationalrat. Ganz Österreich sei von der Konferenz von Moskau enttäuscht, sagt er. Außenminister Karl Gruber (ÖVP) legt detailliert dar, bei welchen Artikeln des Vertrags in Moskau Fortschritte gemacht wurden und woran es noch hakt. Als “Haupthindernis eines raschen Vertragsabschlusses” habe sich die Frage des “deutschen Eigentums” erwiesen. Insbesondere jenes Eigentum, das früher österreichischen Staatsbürger:innen gehört hat und von Deutschland “germanisiert” worden sei – immerhin 800 Unternehmen -, nennt Gruber als Streitpunkt.
Die KPÖ hingegen sieht die “einseitige Westorientierung” der Regierung als Hindernis für die Verhandlungen, wie Abgeordneter Ernst Fischer darlegt. Sein Entschließungsantrag für ein Ende dieser Politik bleibt aber in der Minderheit. Mit Forderungen an die Alliierten kommt die SPÖ. Der vom Abgeordneten Paul Speiser eingebrachte Resolutionsantrag für Erleichterungen vonseiten der Besatzungsmächte wird angenommen. Auf Initiative des ÖVP-Abgeordneten Lois Weinberger fasst der Nationalrat außerdem eine Entschließung, mit der er die Parlamente der ganzen Welt um Hilfe bittet.
1949: Parlament erfährt von Fortschritten
Von Februar bis Mai 1949 treten die Stellvertreter der Außenminister der Alliierten nach fast einjähriger Pause in London zusammen. Als auch diese Verhandlungen wieder schleppend verlaufen, macht das österreichische Parlament Druck. Am 11. Mai 1949 fordert der Nationalrat in einer einstimmigen Entschließung, dass der Staatsvertrag über Österreich endlich abgeschlossen werden muss.
Im Juni 1949 kommt es in Paris schließlich zu Fortschritten. Bundeskanzler Leopold Figl berichtet dem Nationalrat am 22. Juni, die Außenminister der vier Großmächte hätten in Paris den Grundstein zum österreichischen Staatsvertrag gelegt. “Noch ist unser Ziel nicht erreicht. Aber wir fühlen doch wieder festen Boden unter den Füßen. Wir wissen, dass der Tag der endgültigen Befreiung nahegerückt ist”, sagt Figl. Laut der Einigung der Außenminister sollen Österreichs Grenzen unverändert bleiben, die slowenischen und kroatischen Minderheiten im Gegenzug geschützt werden. Für das “deutsche Eigentum” wurde eine Ablöse von 150 Millionen Dollar an die Sowjetunion vereinbart. Bis zum 1. September, berichtet Figl dem Nationalrat, soll der vollständige Vertragsentwurf fertiggestellt werden.
Doch sowohl die USA als auch die Sowjetunion verzögern die Verhandlungen. Der weltweite Konflikt zwischen West und Ost führt dazu, dass die “Österreich-Frage” noch mehrere Jahre lang ungeklärt bleibt.
1953: Hauptausschuss genehmigt neue Verhandlungslinie
Erst 1953 ändern sich die Vorzeichen. Josef Stalin stirbt im März, in der Folge gibt es Erleichterungen im Besatzungsregime. Im April nimmt eine neue österreichische Bundesregierung unter Kanzler Julius Raab (ÖVP) die Arbeit auf. Sie zeigt sich gesprächsbereiter und sendet besonders in einer Frage deutliche Signale in die Welt: Österreich könnte ein neutraler Staat werden.
Am 23. September 1953 befasst sich der Hauptausschuss des Nationalrats mit der neuen Verhandlungslinie der Regierung. Zur Debatte steht eine Note an die sowjetische Regierung, in der Österreich sich bereiterklärt, nicht länger über den von den Westmächten vorgelegten Kurzvertrag zu verhandeln, sondern wieder zum alten Entwurf des Staatsvertrags zurückzukehren. Darin sind neben finanziellen Lasten auch Militärartikel enthalten. Außenminister Karl Gruber gesteht ein, dass diese eine “Einschränkung der Souveränität” bedeuten. Die Nichtteilnahme an militärischen Bündnissen heiße aber nicht, dass eine internationale Zusammenarbeit für Österreich ausgeschlossen sei, zitiert ihn die Parlamentskorrespondenz. Der Hauptausschuss nimmt die Note der Regierung mit breiter Mehrheit, ohne die Stimmen der Wahlpartei der Unabhängigen (WdU), zur Kenntnis.
Februar 1954: Nationalrat muss sich erneut mit gescheiterten Verhandlungen befassen
Und so werden große Hoffnungen in die Außenministerkonferenz gesetzt, die im Jänner und Februar 1954 in Berlin stattfindet. Erstmals sitzt Österreich als gleichberechtigter Verhandlungspartner mit am Tisch. Doch erneut folgt die Enttäuschung. Leopold Figl, der seit November 1953 Außenminister ist, muss dem Nationalrat am 24. Februar 1954 über die gescheiterten Verhandlungen berichten. Die Sitzung war kurzfristig eine Stunde früher als geplant einberufen worden. Nationalratspräsident Felix Hurdes (ÖVP) konstatiert zu Beginn “nicht nur Enttäuschung, sondern – und das mit Recht – große Entrüstung” bei der Bevölkerung.
Figl berichtet detailliert über die Verhandlungen, bei denen die österreichische Delegation erstmals am 12. Februar 1954 anwesend war. Der sowjetische Außenminister Wjatscheslaw M. Molotow habe überraschend gefordert, dass die alliierten Truppen solange in Österreich bleiben, bis ein Friedensvertrag mit Deutschland abgeschlossen werde. “Hohes Haus! Ich brauche Ihnen nicht zu erklären, wie niederschmetternd diese neuen Vorschläge in der ersten Sitzung über den österreichischen Staatsvertrag wirkten”, sagt Figl. Die Bedingungen seien für Österreich “unannehmbar” gewesen.
Alfons Gorbach (ÖVP) resümiert: “Eine Woche des Nervenkrieges ist zu Ende gegangen. Der anfänglichen Erwartung folgte die Enttäuschung”. Die SPÖ habe bereits vor der Konferenz wenig Grund zu Optimismus gehabt, erklärt Bruno Pittermann. Molotow habe in Berlin klar gesagt, was Russland wolle: “Österreich soll nach dem russischen Plan erst dann in den Besitz seiner vollen Souveränität gelangen, wenn die Frage der Neutralisierung Gesamtdeutschlands nach den Wünschen der russischen Politik gelöst ist”. Willfried Gredler (WdU, später FPÖ) spricht von einem “sowjetischen Imperialismus” und einer “Bedrohung des Weltfriedens”. Ernst Fischer (Volksopposition bzw. KPÖ) hingegen meint: “Der Staatsvertrag war in Berlin zu haben” und kritisiert die Regierung dafür, ihn abgelehnt zu haben.
Mai 1955 bringt historisches Datum
Rund ein Jahr später, im April 1955, gelingt schließlich in Moskau der Durchbruch. Im Moskauer Memorandum vom 15. April einigen sich russische und österreichische Vertreter darauf, dass die Sowjetunion den Staatsvertrag unterzeichnet, wenn Österreich seine immerwährende Neutralität nach dem Vorbild der Schweiz deklariert. Außerdem ist die Sowjetunion bereit, das gesamte in russischem Besitz befindliche “deutsche Eigentum” gegen eine Ablöse an Österreich zu übertragen. Vereinbart werden Warenlieferungen im Wert von 150 Millionen Dollar.
Der Weg ist frei für eine Botschafterkonferenz der vier Großmächte und Österreichs im Mai 1955 in Wien. “Ich hoffe zuversichtlich, dass die nächsten Tage jenes historische Datum bringen werden, da für das österreichische Volk Freiheit und Unabhängigkeit gesichert werden”, verkündet Außenminister Figl am 12. Mai im Nationalrat. Es folgt “lebhafter, allgemeiner Beifall”. Das historische Datum ist schließlich der 15. Mai 1955.
Zwei Tage nach der Unterzeichnung des Staatsvertrag, am 17. Mai 1955, tritt der Bundesrat zu einer Sitzung zusammen. Bundesratsvorsitzender Hans Riemer (SPÖ) ist “überaus glücklich darüber, dass wir endlich, zehn Jahre nach Kriegsende, den Staatsvertrag und damit die staatsrechtliche Freiheit unseres Vaterlandes, der Republik Österreich, erreicht haben”.
Juni 1955: Parlament ratifiziert Staatsvertrag
Damit er Gesetzeskraft erlangt, muss der Vertrag nun noch ratifiziert werden. Die österreichische Regierung bringt am 25. Mai den Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich als Regierungsvorlage im Nationalrat ein. Gleichzeitig gibt es einen Allparteienantrag betreffend die Erklärung der Neutralität Österreichs.
Am 1. Juni befasst sich der Hauptausschuss mit der Regierungsvorlage. Neben Bundeskanzler Julius Raab, Vizekanzler Adolf Schärf, Außenminister Leopold Figl und Staatssekretär Bruno Kreisky sind auch “als Zuhörer zahlreiche Mitglieder des Nationalrats, die nicht dem Hauptausschuss angehören”, anwesend, wie die Parlamentskorrespondenz in ihrem 21 Seiten langen Bericht schreibt. Der Abgeordnete Lujo Toncic-Sorinj (ÖVP), der die Rolle als Berichterstatter innehat, spricht von einem “langen, mühevollen Weg” des Staatsvertrags. Das österreichische Volk habe sich den Vertrag “als ein im Herzen immer freies und selbstbewusstes Volk erarbeitet und erkämpft”, sagt er. Auch Bundeskanzler Raab meldet sich zu Wort. Er bezeichnet den Staatsvertrag als einen der wesentlichsten Beiträge Österreichs für die Entspannung der internationalen Gegensätze und betont: “Wir bekennen uns zur Neutralität”. Österreich sei ein neutraler Staat wie die Schweiz. Vizekanzler Schärf begrüßt den Staatsvertrag “aus vollem Herzen”, denn er habe “als Österreicher in erster Linie österreichische Interessen im Auge und auch im Herzen”. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum des Nationalrats einstimmig, den Staatsvertrag zu genehmigen. Auch den Entschließungsantrag für die Ausarbeitung eines Neutralitätsgesetzes befürwortet er einhellig.
Der Tag der Ratifikation des Staatsvertrags durch den Nationalrat kommt schließlich am 7. Juni 1955. “Unsere Geschäftsordnung ist auf den parlamentarischen Alltag zugeschnitten. Was uns aber heute zur Beschlussfassung vorliegt, ist nichts Alltägliches. Die Regierungsvorlage 517 der Beilagen ist keine wie alle anderen. Sie ist die Magna Charta für Österreichs Freiheit und Unabhängigkeit”, sagt Abgeordneter Franz Gschnitzer (ÖVP). Ernst Koref (SPÖ) sieht eine “neue Ära” anbrechen und drückt seine “vorbehaltlose Zustimmung” aus. Beide heben positiv hervor, dass es gelungen sei, den Passus zur österreichischen Mitschuld am Zweiten Weltkrieg aus der Präambel des Vertrags zu streichen. Diese Ansicht prägt bis in die 1980er-Jahre Österreichs Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit.
Johann Koplenig (VO bzw. KPÖ) erläutert ebenfalls, dass seine Fraktion das “historische Dokument” vollständig billigt. Seiner Ansicht nach hat vor allem die “konsequente Politik der Sowjetunion für internationale Entspannung und Verständigung” den Staatsvertrag ermöglicht. Die WdU wiederum stimmt dem Staatsvertrag zu, “nicht, weil wir ihn für einen guten oder gerechten Vertrag halten, sondern einfach deshalb, weil er besser als gar keiner ist”, sagt Viktor Reimann. Der Staatsvertrag wird schließlich einstimmig genehmigt. Nicht Teil des Dokuments, aber politisch freilich verknüpft, ist die Erklärung der Neutralität Österreichs. Der Nationalrat nimmt die entsprechende Resolution am 7. Juni ebenfalls einstimmig an.
Mit der Genehmigung im Bundesrat am 8. Juni 1955 nimmt der Staatsvertrag die letzte Hürde im österreichischen Parlament. Nachdem auch die Sowjetunion, die USA, Großbritannien und Frankreich den Vertrag ratifizieren, tritt er mit 27. Juli 1955 in Kraft. Rechtlich gesehen erhält Österreich an diesem Tag seine Souveränität. Die Räumungsfrist von 90 Tagen für die alliierten Truppen beginnt. Sie endet am 25. Oktober. Der Nationalrat kann am nächsten Tag, dem 26. Oktober 1955, der Entschließung vom Juni folgen und das Bundesverfassungsgesetz über die Neutralität Österreichs beschließen. (PK/kar/IIM)
HINWEISE: Fotos zum Staatsvertrag und seinem parlamentarischen Weg finden Sie im Webportal des Parlaments. Die Stenographischen Protokolle aller Nationalrats- und Bundesratssitzungen finden Sie im Bereich “Recherchieren” im Webportal des Parlaments.
Das Parlament beleuchtet 2025 drei Meilensteine der Demokratiegeschichte. Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg, vor 70 Jahren wurde der Staatsvertrag unterzeichnet und vor 30 Jahren trat Österreich der EU bei. Mehr Informationen zum Jahresschwerpunkt 2025 finden Sie unter www.parlament.gv.at/kriegsende-staatsvertrag-eu-beitritt .