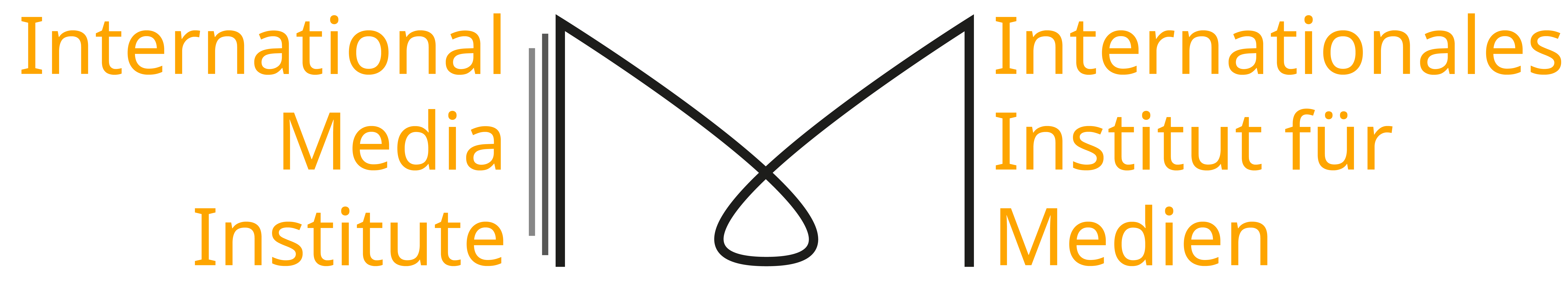Medienklausur: Acht Tische für die Vierte Gewalt
Wien, 16. November 2025 – Mit dem Ziel, gemeinsam Impulse für die Weiterentwicklung und Absicherung der Medienvielfalt & -freiheit in Österreich zu setzen, versammelten sich 66 Persönlichkeiten aus acht Bereichen – Medienmanagement, Herausgeberschaft & Chefredaktionen, Journalist:innen, Brancheninstitutionen, Wissenschaft, Politik, Zivilgesellschaft und Recht – über zwei Tage zu einer Klausur im Schloss Hernstein in Niederösterreich.
Zufrieden zeigten sich Gabriela Bacher (Ein Versprechen für die Republik) und Sebastian Loudon (DATUM Stiftung für Journalismus und Demokratie) mit dem kollaborativen Prozess und den Ergebnissen: „Es ist uns gelungen, mit diesem Experiment erstmals alle an einen Tisch zu holen – von den Branchenverbänden, über VertreterInnen der Politik bis hin zu Medien-Startups und der Zivilgesellschaft und gemeinsam und konstruktiv Vorschläge zu erarbeiten,” freut sich Gabriela Bacher.
Sebastian Loudon ergänzt: „In dieser Atmosphäre der Zusammenarbeit auf Augenhöhe wurden interessante Perspektiven sichtbar. Als Ergebnis haben wir nun Impulse, von denen wir hoffen, dass sie der Politik und den Medienschaffenden auf dem weiteren Weg nützlich sein werden.“
Von den konkreten Handlungsempfehlungen befassten sich die meisten mit Vorschlägen zu der Frage, wie die staatliche Medienförderung weiterentwickelt bzw. umgebaut werden kann, um freie Medien und unabhängigen Journalismus bestmöglich zu garantieren. Dass der Staat auch finanziell für journalistische Vielfalt sorgt, befürwortet auch eine Mehrheit der Bevölkerung, wie eine eigens im Vorfeld der Veranstaltung durchgeführte repräsentative Meinungsumfrage ergab.
Bestehende Förderungen sollten vereinheitlicht und aus einem Guss gestaltet werden. Die Förderungen sollten von einer unabhängigen, staatsfernen Jury nach objektivierbaren, messbaren Kriterien vergeben werden. Auf Innovation, Resilienz und Nachhaltigkeit, sowie junge Medienkanäle, wie die „Creator Economy“, sollte dabei ebenfalls Wert gelegt werden.
Die transparente Einhaltung journalistischer und verlegerischer Standards nach einem offenen Kriterienkatalog sollte, wie in anderen Ländern üblich, die Grundvoraussetzung für den Erhalt staatlicher Förderung sein.
Das Volumen der Werbeausgaben der Bundesregierung sollte auf ein europäisches Durchschnittsniveau gesenkt werden. Die durch diese Deckelung eingesparten Mittel sollten für die Aufstockung der Medienförderung aufgewendet werden.
Das Bekenntnis zu einer pluralistischen Medienlandschaft sowie die Existenz des ORF und seine gesicherte Finanzierung und Programmnormen sollten explizit ins Bundesverfassungsgesetz aufgenommen werden. Das Informationsfreiheitsgesetz sollte konsequent durchgesetzt werden.
Was die Big-Tech-Plattformen betrifft, wurde eine effiziente Regulierung im europäischen Zusammenspiel mit besonderem Fokus auf Jugendschutz, Urheberrecht, Inhalteverantwortung, Steuerfairness und Transparenz befürwortet. Als Sanktionsmöglichkeit wurde der Zugriff auf Werbeerlöse der Tech-Plattformen vorgeschlagen. Zudem wurde die forcierte Entwicklung europäischer Alternativen zu den Big-Tech-Angeboten wie zum Beispiel durch den Ausbau des „European Public Open Space“ empfohlen. Dies sollte im Schulterschluss zwischen den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (EBU), Verlegern und privaten elektronischen Medienanbietern vorangetrieben werden.
Große Bedeutung wurde auch dem Thema Medienkompetenz eingeräumt. Konkret wird empfohlen, „Medien und Demokratie“ in Schulen als fächerübergreifende Kompetenz einzuführen.
Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) begrüßt grundsätzlich Initiativen, die sich der nachhaltigen Absicherung des heimischen Medienstandorts widmen, vermisst bei den Handlungsempfehlungen der „Acht Tische für die Vierte Gewalt“ allerdings rechtliche Machbarkeit.
„Den Veranstaltern war ein Bemühen nicht abzusprechen, einen breiten Dialog mit vielen Interessengruppen zu führen. Allerdings fehlte dem Teilnehmerkreis Ausgewogenheit und Repräsentativität im Sinne der gesamten österreichischen Medienbranche“, sagt VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger. Daher fehle der quantitativen Abstimmung einer Vielzahl an unterschiedlichen Wunschvorstellungen letztendlich die zur Umsetzung erforderliche Akzeptanz sowie ein breiter Konsens.
Zwar könne bei manchen Themen von einem breiteren Schulterschluss ausgegangen werden, so Grünberger, „etwa, wenn es um die Förderung von Medienkompetenz sowie die Stärkung des Vertrauens in journalistische Angebote bzw. das Eintreten für eine pluralistische und resiliente Medienökonomie geht. Auch die Forderung nach einer stärkeren Regulierung von Big-Tech-Plattformen und die Stärkung des Werts von Journalismus durch eine Fokussierung auf Bezahlangebote sind vernünftige Ansätze.“
Allerdings kritisiert der VÖZ-Geschäftsführer, dass der Großteil, der im Zuge der Veranstaltung aufgestellten Forderungen von einer gewissen Praxisferne gekennzeichnet ist. „Insbesondere die rechtliche Machbarkeit und Umsetzung spielten bei einem Gutteil der Überlegungen bedauerlicherweise eine untergeordnete Rolle. Vor diesem Hintergrund kann der Verband Österreichischer Zeitungen die Handlungsempfehlungen nicht mittragen. Wir bedanken uns für das gesetzte Engagement und begrüßen weiterhin Initiativen, um die Zukunft des Medienstandorts Österreich nachhaltig abzusichern“, betont Grünberger.
Initiiert wurde die Stakeholder-Konferenz von „Ein Versprechen für die Republik“ und der „DATUM Stiftung für Journalismus und Demokratie“. Unterstützt wurde die Initiative von der „ERSTE Stiftung“, der „RD Foundation Vienna“, der Industriellenvereinigung, Anton Schneider, der Wirtschaftskammer Wien und #aufstehn. (OTS/IIM)